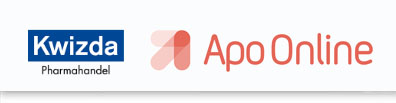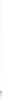Ernährungslehre kompakt
Teil 3: Mineralstoffe
Mineralstoffe sind anorganische Bestandteile der Nahrung, die der Körper nicht selbst bilden kann. Sie sind keine Energieträger und relativ unempfindlich gegenüber Hitze und Luft (Sauerstoff). Sie können aber durch Wasser (beim Waschen und Kochen) ausgelaugt werden.
Aufgaben der Mineralstoffe
- Baustoffe sind wesentliche Bestandteile des menschlichen Skeletts und der Zähne (z. B. Calcium, Phosphor)
- Reglerstoffe beeinflussen in gelöster Form als Ionen die physikalischen und chemischen Eigenschaften der Körperflüssigkeiten (u. a. den Innendruck der Zellen somit die Gewebespannung). Beispielsweise: Natrium und Kalium.
- Bestandteile von Enzymen (Eisen, Kupfer, Zink, Molybdän, Mangan) oder organischen Verbindungen (Iod von Thyroxin, Kobalt von B12, Eisen von Hämo- und Myoglobin)
Mengen- oder Spurenelement?
Mengenelemente sind zu mindestens 50 mg pro kg Knochentrockenmasse enthalten, Spurenelemente liegen, mit Ausnahme von Eisen, darunter.
Die Mengenelemente sind am Aufbau von Knochen und/oder Zähnen beteiligt, zudem an der Reizweiterleitung, der Muskelkontraktion, der Stabilisierung des pH-Wertes (Säure-Basen-Haushalt) und dem Wasserhaushalt. Zu den Mengenelementen zählen: Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium, Phosphor, Chlor und Schwefel.
Spurenelemente werden für den reibungslosen Ablauf von Stoffwechselabläufen benötigt. Als wichtige Vertreter wären zu nennen: Jod, Eisen, Selen, Molybdän, Zink, Chrom, Kupfer und Mangan.
Mineralstoffe im Detail
a) Mengenelemente
1. Calcium (Ca)
Der Körper eines erwachsenen Mannes enthält 0,9 bis 1,3 kg Calcium, jener einer Frau zwischen 0,75 und 1,1 kg. Mehr als 99% davon befindet sich in Knochen und Zähnen.
Oxalate (z.B. aus Rhabarber und Spinat), Phytate und Lignine (aus Vollkornprodukten und Hülsenfrüchten) wirken eher hemmend auf die Aufnahme von Calcium. Dies spielt aber bei
üblichen Ernährungsgewohnheiten nur eine untergeordnete Rolle.
Funktionen
- Bestandteil von Knochen und Zähnen
- Reizübertragung im Nervensystem und Erregbarkeit von Muskelzellen
- Blutgerinnung
- Ausschüttung von Hormonen und Signalstoffen
- fördert die Aufnahme von Calcium.
Mangelerscheinungen
- Ein leichter Mangel führt zu Müdigkeit, Muskelkrämpfen und erhöhter Blutungsneigung
- Bei schwerem Mangel kommt es zu Herzrhythmusstörungen, Krampfanfällen, Störungen im Phosphathaushalt sowie Knochenerkrankungen (z. B. Osteoporose).
Überdosierung
Als unbedenkliche obere Zufuhrmenge für Erwachsene gelten 2 g (Bedingung: Urinvolumen größer als 2 Liter pro Tag).
Symptome: Calciumablagerungen in den Weichteilen sowie bei entsprechend veranlagten
Personen mit ungenügender Trinkmenge Harnsteine sein.
Referenzwerte für die tägliche Zufuhr (Empfehlungen)
| Kinder (altersabhängig) | Mädchen, Knaben 600-1200 mg |
| Jugendliche | Mädchen, Knaben 1200 mg |
| Erwachsene | Frauen, Männer 1000 mg |
| Schwangere | 1000 mg |
| Stillende | 1000 mg |
Nahrungsquellen:
Parmesan, Emmentaler, Tilsiter, Gauda, Leinsamen, Amaranth, Sojabohnen, weiße Bohnen, Dinkel, Seelachs, Hühnerbrust, Vollmilch, Sardinen in Öl, calciumreiches Mineralwasser (mehr als 300 mg Ca/l)
2. Kalium (Ka)
Der Körper eines erwachsenen Mannes enthält 150 g, jener einer Frau 100 g Kalium. 98% davon befinden sich in den Zellen (= intrazellulär).
Auf Schwankungen der extrazellulären Kaliumkonzentration reagiert der Körper sehr rasch mit neuromuskulären bzw. muskulären Störungen.
Funktionen
- Reguliert mit Natrium den Wasserhaushalt des Körpers und den osmotischen Druck in den Zellen. Es wirkt dabei als Gegenspieler von Natrium.
- Regulation des Säure-Basen-Haushaltes
- Erregbarkeit von Muskeln und Nerven
- Wichtig für das Wachstum der Zellen
- Eiweiß- und Glykogenbildung
- Ausschüttung von Hormonen.
Mangelerscheinungen
Bei üblicher Ernährung ist ein Kaliummangel sehr selten. Auslöser können jedoch lang anhaltender Durchfall, Erbrechen sowie die Einnahme von Abführmitteln (Laxantien) oder entwässernden Mitteln (Diuretika) sein.
Mangelsymptome: Muskelschwäche, Darmlähmung, Herzfunktionsstörungen.
Überdosierung
Eine unbedenkliche obere Zufuhrmenge ist nicht definiert.
Eine Kaliumvergiftung (auf Grund gestörter Kaliumausscheidung bei Niereninsuffizienz, Digitalisvergiftung oder Acidose z. B. bei diabetischem Koma) führt zu Herzrhythmus- und Nervenstörungen, Ohrensausen, Verwirrtheit sowie Halluzinationen.
Referenzwerte für die tägliche Zufuhr (Schätzwerte)
| Kinder (altersabhängig) | Mädchen, Knaben 1000-1900 mg |
| Jugendliche | Mädchen, Knaben 2000 mg |
| Erwachsene | Frauen, Männer 2000 mg |
| Schwangere | 2000 mg |
| Stillende | 2000 mg |
Nahrungsquellen:
Sojabohnen und –mehl, getrocknete Marillen, Pistazien, Weizenkeime, Linsen, Roggen, Dinkel, Kartoffeln, Dorsch, Puten- und Hühnerbrust, Mandeln, Spinat, Bananen, Brokkoli
3. Magnesium (Mg)
Der Körper eines Erwachsenen enthält ca. 25 g Magnesium. 60% davon befinden sich in den Knochen, 30% in den Muskeln.
Funktionen
- Reizübertragung im Nervensystem und Muskelkontraktion
- Aufbau von Knochen und Zähnen
- Aktiviert zahlreiche Enzyme, besonders jene des Energiestoffwechsels
- DNA-Synthese
- Blutgerinnung (Gegenspieler von Calcium).
Mangelerscheinungen
Bei üblicher Ernährung ist ein Magnesiummangel sehr selten. Auslöser können jedoch sein: chronischer Alkoholkonsum, Dauertherapie mit bestimmten Medikamenten, Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes, Schwangerschaft und Stillzeit.
Symptome: Funktionsstörungen von Herz- und Skelettmuskulatur, Neigung zu Muskelkrämpfen.
Überdosierung
Als unbedenkliche obere Zufuhrmenge für Erwachsene gelten 350 mg (zusätzlich zu den Magnesiummengen aus der Nahrung).
Symptome. Blutdrucksenkung, Müdigkeit, Hautrötungen, Herzrhythmusstörungen. Bei eingeschränkter Nierenfunktion und/oder zu hoher parenteraler Zufuhr wurden Muskellähmungen und Todesfälle beobachtet.
Referenzwerte für die tägliche Zufuhr (Empfehlungen)
| Kinder (altersabhängig) | Mädchen, Knaben 80-310 mg |
| Jugendliche | Mädchen 350mg Knaben 400 mg |
| Erwachsene | Frauen 300 mg Männer 350 mg |
| Schwangere | 310 mg |
| Stillende | 390 mg |
Nahrungsquellen:
Sonnenblumenkerne, Amaranth, Sojabohnen, Mandeln, Walnüsse, weiße Bohnen, Weizenschrot- oder Vollkornbrot, getrocknete Feige, Erdnüsse, Haferflocke, Naturreis, Vollkornteigwaren, Bananen
4. Natrium (Na)
Der Körper eines erwachsenen Mannes enthält 100 g, jener einer Frau rund 80 g Natrium.
Ist gemeinsam mit Chlorid Bestandteil von Speise- bzw. Kochsalz (= Natriumchlorid).
Funktionen
- Reguliert zusammen mit Kalium den Wasserhaushalt des Körpers und den osmotischen Druck in den Zellen. Es wirkt dabei als Gegenspieler von Kalium.
- Aufnahme und Transport von Nährstoffen
- Regulation des Säure-Basen-Haushaltes
- Erregbarkeit von Muskeln und Nerven.
Mangelerscheinungen
Bei üblicher Ernährung ist ein Natriummangel sehr selten. Auslöser können jedoch lang anhaltender Durchfall, Erbrechen oder starkes Schwitzen sein.
Mangelsymptome: Blutdruckabfall, Herzrhythmusstörungen, Krämpfe, Schwäche und Teilnahmslosigkeit.
Überdosierung
- Als unbedenkliche obere Zufuhrmenge für Erwachsene gelten 6 g Kochsalz (dies entspricht 2,4 g Natrium).
- Zeichen einer Überdosierung sind Bluthochdruck (Hypertonie) bei entsprechend veranlagten (salzsensitiven) Personen sowie eine vermehrte Ausscheidung von Calcium über den Urin.
Referenzwerte für die tägliche Zufuhr (Schätzwerte)
| Kinder (altersabhängig) | Mädchen, Knaben 300-550 mg |
| Jugendliche | Mädchen, Knaben 550 mg |
| Erwachsene | Frauen, Männer 550 mg |
| Schwangere | 550 mg |
| Stillende | 550 mg |
Nahrungsquellen:
Speisesalz, geräucherte Fisch-, Fleisch- und Wurstwaren, Limburger, Sardellen in Öl, Oliven, schwarz, Knabbergebäck, Fertigprodukte, Roquefort, Ketchup
5. Phosphor (P)
Der Körper eines Erwachsenen enthält zwischen 600 und 700 g Phosphor. Mehr als 85% davon befinden sich in Knochen und Zähnen.
Funktionen
- Bestandteil der Erb- und Knochensubstanz
- Energiestoffwechsel.
- Säure-Basen-Haushalt.
Mangelerscheinungen
Bei üblicher Ernährung ist ein Phosphormangel sehr selten, da fast alle Nahrungsmittel Phosphor enthalten. Auslöser können jedoch eine parenterale Ernährung mit unzureichender Phosphorzufuhr, verschiedene Erkrankungen sowie die Einnahme gewisser Medikamente (so genannter Phosphatbinder) sein.
Mangelsymptome: allgemeine körperliche Schwäche, Appetitlosigkeit, Knochenschmerzen, Erbrechen.
Überdosierung
Bei Gesunden sind keine Gefahren einer Überdosierung bekannt.
Bei eingeschränkter Nierenfunktion hingegen kann es zu Hyperphosphatämie (zu hoher Phosphatspiegel im Blut), Nierenverkalkung und zu Störungen im Knochenstoffwechsel kommen.
Referenzwerte für die tägliche Zufuhr (Empfehlungen)
| Kinder (altersabhängig) | Mädchen, Knaben 500-1250 mg |
| Jugendliche | Mädchen, Knaben 1250 mg |
| Erwachsene | Frauen, Männer 700 mg |
| Schwangere | 800 mg |
| Stillende | 900 mg |
Nahrungsquellen:
Hülsenfrüchte, Schmelzkäse, Parmesan, Bergkäse, Leinsamen, Pistazien, Grahambrot, Forelle, Schweinsfilet, Hühnerbrust, Topfen mager
6. Chlorid (Cl)
Ist das häufigste Anion der extrazellulären Flüssigkeit. Hohe Konzentrationen finden sich im Liquor cerebrospinalis sowie in den Verdauungssekreten.
Funktionen
- Spielt eine wichtige Rolle in der Ionenbilanz (Aufrechterhaltung der Elektronenneutralität) sowie im Säure-Basen-Haushalt (Pufferwirkung).
- Bestandteil der Magensalzsäure.
Mangelerscheinungen
Ein Mangel kann beispielsweise durch häufiges starkes Erbrechen auftreten.
Symptome: Wachstumsstörungen und Muskelschwäche, metabolische Alkalose.
Überdosierung
Störungen in der Erregungsleitung sowie im Wasser- und Säure-Basen-Haushalt
Referenzwerte für die tägliche Zufuhr
| Kinder (altersabhängig) | Mädchen, Knaben 450-830 mg |
| Jugendliche | Mädchen, Knaben 830 mg |
| Erwachsene | Frauen, Männer 830 mg |
| Schwangere | 830 mg |
| Stillende | 830 mg |
Nahrungsquellen: siehe Natrium
7. Schwefel (S)
Funktionen
- Bestandteil von schwefelhaltigen Aminosäuren (Cystein und Methionin) und Vitaminen (Thiamin, Biotin).
- Entgiftung von Steroiden, Phenolen und Indoxyl.
- Sulfatgruppen kommen in Schleimsubstanzen, Mucopolysacchariden und Mucoproteiden vor.
- Energiestoffwechsel (Coenzym-A)
- Bestandteil von Heparin, das bei der Blutgerinnung hemmend wirkt
- Bestandteil von Chrondroidinsulfat, welches im Knorpel vorkommt.
Mangelerscheinungen
Bis dato nicht bekannt.
Bedarf, wünschenswerte Zufuhr:
Bisher existieren keine Bedarfszahlen, da eine ausreichende Schwefelzufuhr bei angemessener Proteinaufnahme gesichert ist.
Nahrungsquellen:
Fleisch, Eier, Milch und Milchprodukte, Nüsse, Leguminosen. In Meerrettich, Kresse, Senf, Kohl, Zwiebeln und Lauch liegen sie in Form von Senfölglykosiden vor.
b) Ausgewählte Spurenelemente im Detail
Die hohe Zufuhr eines Spurenelements kann einen sekundären Mangel an einem anderen Spurenelement bewirken. Von direkten Interaktionen spricht man, wenn ein Element eine kompetitive Hemmung der intestinalen Absorption oder der Gewebefreisetzung eines anderen Elements verursacht, wobei zumindest zwei Elemente den gleichen Transportmechanismus oder gleiche Liganden besitzen wie z. B. Kupfer, Zink und Cadmium; Eisen und Mangan.
Indirekte Interaktionen treten auf, wenn ein Element in den Metabolismus eines anderen Elements involviert ist, wie z. B. Kupfer als Bestandteil von Ceruloplasmin bei der Eisenmobilisation.
Bis auf wenige Ausnahmen reichen die über Nahrungsmittel aufgenommenen Mineralstoffmengen nicht aus, um Imbalancen hervorzurufen. Letztere können jedoch durch überdosierte Supplementierung bzw. die überhöhte Aufnahme angereicherter Lebensmittel hervorgerufen werden.
Ursachen für einen Spurenelement-Mangel:
- Geringe Aufnahme/Bioverfügbarkeit
- Systemische Defekte der Absorption/Utilisation (Stoffwechselerkrankungen, Magen-/Darmresektion, Pankreasinsuffizienz)
- Negative Bilanz (Nierenfunktionsstörungen, Blutverlust, Hämolyse, Chelattherapie)
- Erhöhter Bedarf (Schwangere, Stillende, Rekonvaleszenz, Neugeborene mit niedrigem Körpergewicht, Kinder).
1. Eisen (Fe)
Der Körper eines Erwachsenen enthält ca. 2 bis 4 g Eisen. Ungefähr 60% davon sind an Hämoglobin gebunden. Man unterscheidet zwischen Hämeisen (in Fleisch, Fisch) und Nicht-Hämeisen (in Eiern, Milchprodukten, pflanzliche Nahrungsmittel). Hämeisen kann vom Körper effizienter aufgenommen werden als Nicht-Hämeisen.
Funktionen
- Sauerstofftransport, -speicherung und -aktivierung.
- Immunsystem (Abwehrsystem des Körpers)
- Energieverwertung
- Synthese von Gallensäuren und Steroidhormonen
Mangelerscheinungen
- Blutarmut = Anämie (blasse Haut und Schleimhaut, schnelle Ermüdung, Konzentrationsschwäche)
- Infektanfälligkeit
- brüchige Haare und Nägel
Anmerkung: Säuren wie z. B. Vitamin C oder Zitronensäure sowie Fleisch, Fisch und Geflügel begünstigen die Aufnahme von Nicht-Hämeisen. Tannine (z. B. aus Rotwein und Schwarztee), Phytate und Lignine (aus Vollkornprodukten und Hülsenfrüchten), Phosphate (z. B. aus Colagetränken), Oxalsäuren (z.B. aus Rhabarber und Spinat), Calciumverbindungen (z. B. aus Milch) sowie Salicylate (z. B. Aspirin) wirken hemmend auf die Aufnahme von Nicht-Hämeisen.
Überdosierung
Als unbedenkliche obere Zufuhrmenge für Erwachsene gelten 45 mg.
Symptome: Schädigungen von Leber, Bauchspeicheldrüse und Herz.
Referenzwerte für die tägliche Zufuhr (Empfehlungen)
| Kinder (altersabhängig) | Mädchen 15 mg Knaben 12 mg |
| Jugendliche | Mädchen 15 mg Knaben 12 mg |
| Erwachsene | Frauen 15 mg Männer 10 mg |
| Schwangere | 30 mg |
| Stillende | 20 mg |
Nahrungsquellen:
Rindfleisch, Kakaopulver, mager, Sesam, Mohn, Sojabohne, Linsen, Leberwurst, getrocknete Aprikosen, Kalbfleisch, Spinat, Lachs
2. Fluorid (F)
Der Körper eines Erwachsenen enthält ca. 2 bis 5 g Fluorid. Es befindet sich fast ausschließlich in den Knochen und Zähnen.
Funktionen
- gewisse Karies vorbeugende Wirkung.
- Mineralisation von Knochen und Zähnen.
Mangelerscheinungen
Erhöhtes Risiko für Karies.
Gefahren bei Überdosierung
- Als unbedenkliche obere Zufuhrmenge für Erwachsene gelten 10 mg.
- Symptome einer akuten Überdosierung (mehr als 1 mg/kg Körpergewicht) sind Übelkeit, Erbrechen und Bauchschmerzen.
- Zeichen einer chronischen Überdosierung (mehr als 10 mg/Tag über mehr als 10 Jahre) sind Skelettfluorose mit Gelenkschmerzen und -versteifungen. Bei Kindern bis 8 Jahren führt eine chronische Überdosierung (mehr als 0,1 mg/kg Körpergewicht/Tag) außerdem zu weißlichen bis bräunlichen Zahnverfärbungen.
Referenzwerte für die tägliche Zufuhr (Richtwerte)
| Kinder (altersabhängig) | Mädchen 2,9 mg Knaben 3,2 mg |
| Jugendliche | Mädchen 2,9 mg Knaben 3,2 mg |
| Erwachsene | Frauen 3,1 mg Männer 3,8 mg |
| Schwangere | 3,1 mg |
| Stillende | 3,1 mg |
Nahrungsquellen:
Fluoridiertes Speisesalz, geräucherter Lachs, Walnüsse, Ölsardinen, Stockfisch, Sojabohnen, Hering
3. Iod (I)
Der Körper eines Erwachsenen enthält zwischen 10 und 20 mg Jod. Mehr als die Hälfte davon befindet sich in der Schilddrüse.
Funktionen
Bestandteil der Schilddrüsenhormone, welche im menschlichen Stoffwechsel eine zentrale Rolle spielen.
Mangelerscheinungen
- Vergrößerte Schilddrüse bis hin zum Kropf, begleitet durch Über- oder Unterfunktion der Schilddrüse.
- Bei Kindern: verlangsamte körperliche und geistige Entwicklung.
- Bei Ungeborenen: Kretinismus mit Schädigungen und Entwicklungsstörungen des zentralen Nervensystems, Skeletts sowie gewisser Organe.
Überdosierung
Als unbedenkliche obere Zufuhrmenge für Erwachsene gelten 500 µg.
Symptome: Jod-Akne, Jod-Kropf und Schilddrüsenüberfunktion. Diese treten aber erst beim
Überschreiten der empfohlenen Zufuhr um eine oder mehrere Zehnerpotenzen auf, z. B. infolge Einnahme jodhaltiger Medikamente.
Referenzwerte für die tägliche Zufuhr (Empfehlungen)
| Kinder (altersabhängig) | Mädchen 150 µg Knaben 150 µg |
| Jugendliche | Mädchen, Knaben 150 µg |
| Erwachsene | Frauen, Männer 150 µg |
| Schwangere | 200 µg |
| Stillende | 200 µg |
Nahrungsquellen:
jodiertes Speisesalz, Dorsch (Kabeljau), Seelachs, Garnelen, Scholle, Thunfisch in Öl, abgetropft, Emmentaler, Champignons
4. Kupfer (Cu)
Der Körper eines Erwachsenen enthält ca. 80 bis 100 mg Kupfer.
Funktionen
- Bestandteil von verschiedenen Metalloenzymen. So sind sie u. a. beteiligt an der Synthese von Neurotransmittern (Botenstoffe des Nervensystems) und Kollagen (Bindegewebe). Viele dieser Enzyme besitzen auch antioxidative Funktionen.
- Spielt eine wichtige Rolle im Eisenstoffwechsel.
Mangelerscheinungen
Bei üblicher Ernährung ist ein Kupfermangel sehr selten. Auslöser können hingegen seltene Erbkrankheiten sein.
Mangelsymptome: Anämie (Blutarmut), Knochenbrüche, verminderte Pigmentation von Haut und Haaren, Störungen des Nervensystems.
Hohe Dosen an Calcium, Zink, Eisen und Cadmium vermindern die Kupferaufnahme.
Überdosierung
Eine akute Kupfervergiftung kommt selten vor, kann aber nach Genuss von sauren Lebensmitteln/Getränken die in Kupfergefäßen gelagert wurden vorkommen. Auch Trinkwasser kann durch kupferhaltige Pestizide belastet sein. Mögliche Symptome: Durchfall, Übelkeit, Erbrechen.
Referenzwerte für die tägliche Zufuhr (Schätzwerte)
| Kinder (altersabhängig) | Mädchen, Knaben 1–1,5 mg |
| Jugendliche | Mädchen, Knaben 1–1,5 mg |
| Erwachsene | Frauen, Männer 1–1,5 mg |
| Schwangere | 1–1,5 mg |
| Stillende | 1–1,5 mg |
Nahrungsquellen:
Kakaopulver, Cashewnüsse, Hagebutte, Kaffee geröstet, Haselnüsse, Mandeln, Sojabohne, Weizenkeime, getrocknete Aprikosen, Sonnenblumenkerne, Emmentaler, dunkle Schokolade
5. Selen (Se)
Es ist nicht bekannt, wie viel Selen der menschliche Körper enthält.
Funktionen
- Schützt die Zellen vor schädlichen Radikalen (= Antioxidans) sowie vor Belastungen durch Schwermetalle
- Unentbehrlich für den Zellstoffwechsel
- Fortpflanzung (Fruchtbarkeit)
- Aktivierung der Schilddrüsenhormone
- Von Bedeutung für das Immunsystem
Mangelerscheinungen
Selenmangel kann bei eiweißarmer Kost oder durch die Aufnahme von Lebensmitteln mit geringem Selengehalt vorkommen.
Mangelsymptome: Störungen der Muskelfunktion, Nagelveränderungen, dünne, blasse Haut.
Überdosierung
- Als unbedenkliche obere Zufuhrmenge für Erwachsene gelten 400 µg.
- Symptome einer akuten Überdosierung sind knoblauchartiger Atemgeruch, Übelkeit, Bauchschmerzen und Leberschäden.
- Zeichen einer chronischen Überdosierung (mehr als 800 µg/Tag) sind Haarausfall, brüchige Nägel, schuppige Haut und Nervenleiden.
Referenzwerte für die tägliche Zufuhr (Schätzwerte)
| Kinder (altersabhängig) | Mädchen 25–60 µg Knaben 25–60 µg |
| Jugendliche | Mädchen, Knaben 30–70 µg |
| Erwachsene | Frauen, Männer 30–70 µg |
| Schwangere | 30–70 µg |
| Stillende | 30–70 µg |
Nahrungsquellen:
Steinpilz, Hummer, Weizenkleie, Thunfisch, Sardine, Dorsch (Kabeljau), Eierteigwaren, Schweinefleisch, Eier
6. Zink (Zn)
Der Körper eines Erwachsenen enthält ca. 2 g Zink. Ungefähr 70% davon befinden sich in Knochen, Haut und Haaren.
Funktionen
- Bestandteil oder Aktivator vieler Enzyme des Eiweiß-, Kohlenhydrat-, Fett- und Nukleinsäurestoffwechsels sowie von Hormonen und Rezeptoren.
- Insulinspeicherung
- Unerlässlich für das Immunsystem
Mangelerscheinungen
- Verminderte Geschmacksempfindung, Appetitlosigkeit.
- Störungen der Wachstums- und Geschlechtsentwicklung.
- Erhöhte Infektanfälligkeit, verzögerte Wundheilung.
- Haarausfall.
Überdosierung
- Als unbedenkliche obere Zufuhrmenge für Erwachsene gelten 30 mg.
- Symptome einer akuten Überdosierung sind Magen-Darm-Störungen, Fieber sowie Wechselwirkungen mit dem Eisen- und Kupferstoffwechsel. Grund für eine akute Zinkvergiftung kann der Konsum säurehaltiger Lebensmittel oder das Trinken von Wasser aus verzinkten Gefäßen sein.
- Eine chronische Überdosierung führt zu einer Anämie (Blutarmut).
Referenzwerte für die tägliche Zufuhr (Empfehlungen)
| Kinder (altersabhängig) | Mädchen 7 mg Knaben 9,5 mg |
| Jugendliche | Mädchen 7 mg Knaben 10 mg |
| Erwachsene | Frauen 7 mg Männer 10 mg |
| Schwangere | 10 mg |
| Stillende | 11 mg |
Nahrungsquellen:
Emmentaler, Paranuss, Rindfleisch, Kalbfleisch, Huhn, Hühnerei, Weizenkeime, Kürbiskerne, Haferflocken, Linsen, Pastinake, Brokkoli, geröstete Erdnüsse, Avocado
7. Mangan (Mn)
Der Manganbestand des menschlichen Körpers beträgt ca. 10-40mg. Vor allem die Knochen weisen einen hohen Mangangehalt auf.
Allgemeines
Der menschliche Körper enthält etwa 10 bis 40 Milligramm Mangan. Davon befinden sich etwa 25 Prozent in den Knochen. Auch die Leber, die Nieren und die Bauchspeicheldrüse weisen im Vergleich zu anderen Organen einen hohen Mangananteil auf.
Funktionen
- Es ist Bestandteil verschiedener Enzyme
- Beteiligt am Aufbau von Bindegewebe, der Bildung von Harnstoff sowie der Produktion körpereigener Eiweiße und Fettsäuren
- Verbesserung der Insulinwirkung
- Herstellung des Pigments Melanin sowie des Botenstoffs Dopamin.
Mangelerscheinungen
Ein Manganmangel kommt bei einer ausgewogenen Ernährung nicht vor. In Tierversuchen konnten Knochenveränderungen und Unfruchtbarkeit festgestellt werden. Es wird vermutet, dass ein Mangel an Mangan auch dazu führt, dass die Körperzellen schlechter auf das Hormon Insulin ansprechen.
Überdosierung
Vergiftung mit Mangan kommt äußerst selten vor. Lediglich die Einnahme hoch dosierter Manganpräparate über einen längeren Zeitraum hinweg kann zu Vergiftungserscheinungen führen. Symptome: Konzentrationsstörungen, Schweißausbrüche, Müdigkeit, Impotenz oder Gangunsicherheit.
Eine akute Vergiftung kann zu einer schweren Lungenentzündung (Pneumonie) führen und tödlich sein. Die chronische Vergiftung äußert sich durch parkinsonähnliche Symptome wie Zittern, Muskelsteifheit sowie Konzentrations- und Gedächtnisstörungen. Weitere Beschwerden sind Schwindel, Müdigkeit und Apathie.
Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr
| Kinder (altersabhängig) | Mädchen, Knaben 1-5 mg |
| Jugendliche | Mädchen, Knaben 2-5 mg |
| Erwachsene | Frauen, Männer 2-5 mg |
| Schwangere | 2-5 mg |
| Stillende | 2-5 mg |
Nahrungsquellen
Haferflocken, Weizenkleie, Hirse, Maroni, Naturreis, Brombeeren, Himbeeren, Eierteigwaren, Paranüsse
8. Molybdän (Mo)
Es ist Bestandteil verschiedener Enzyme (z. B. Freisetzung von Eisen, Harnsäurebildung, Abbau von Sulfit zu Sulfat, Fett- und Kohlenhydratstoffwechsel).
Mangelerscheinungen
Ein Molybdänmangel kommt unter normalen Ernährungsbedingungen nicht vor.
Überdosierung
Eine Überdosierung von Molybdän aus der Nahrung ist bei Menschen normalerweise nicht möglich. Vergiftungserscheinungen sind nicht bekannt.
Durch die Aufnahme von hoch dosierten Supplementen kann es zur vermehrten Harnsäurebildung kommen. Auch die Ausscheidung von Kupfer wird begünstigt.
Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr (Schätzwerte)
| Kinder (altersabhängig) | Mädchen, Knaben 25-100 µg |
| Jugendliche | Mädchen, Knaben 50-100 µg |
| Erwachsene | Frauen, Männer 50-100 µg |
| Schwangere | 50-100 µg |
| Stillende | 50-100 µg |
Nahrungsquellen:
Hülsenfrüchte, Reis, Nudeln, Kartoffeln, Hühnerfleisch, Milch und Milchprodukte, Weizenkeime, Eier
9. Chrom (Cr)
Chrom lagert sich nach langjähriger hoher Einnahme vor allem in Lunge, Milz, Leber, Niere und Herz ab, kommt aber auch vermehrt in Knochen, Fett und Muskeln vor.
Funktionen
- Energiestoffwechsel, da es die Aufnahme von Glucose in die Zelle fördert.
- Regulation des Serum-Cholesterinspiegels
Mangelerscheinungen:
Chrom gehört zu jenen Spurenelementen, bei denen es leicht zu einer Unterversorgung kommen kann.
Wichtige Symptome sind: ein erhöhter Glucosespiegel, Glucose im Urin, Gewichtsverlust sowie häufiges Durstgefühl.
Überdosierung
Durch die Aufnahme besonders chromhaltiger Nahrungsmittel ist das Auftreten von Vergiftungserscheinungen eher unwahrscheinlich.
Zu Chromvergiftungen kommt es vor allem bei Personen, die beruflich häufig Kontakt zu sechswertigen Chromverbindungen haben (Gerbereien, Färbereien oder Galvanik). Sechswertiges Chrom ist zum Beispiel in Zement enthalten und kann bei entsprechend exponierten Personen Allergien, Vergiftungserscheinungen oder Krebs auslösen. Ferner sind sechswertige Chromverbindungen in Holzschutzmitteln und Insektenvernichtungsmitteln zu finden. Häufig sind auch die druckimprägnierten Hölzer im Garten mit Chromsalzen (Chromaten) belastet.
Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr
| Kinder (altersabhängig) | Mädchen, Knaben 20-100 µg |
| Jugendliche | Mädchen, Knaben 20-100 µg |
| Erwachsene | Frauen, Männer 30-100 µg |
| Schwangere | 30-100 µg |
| Stillende | 30-100 µg |
Nahrungsquellen:
Schwarzer Tee, Paranuss, Gauda, Edamer, Kakaopulver, Weizenvollkornbrot, Mais
10. Toxische Spurenelemente
üben im Körper keine spezifische Funktion aus und können bereits bei geringer Dosierung schwerwiegende Auswirkungen haben, so führt eine erhöhte Zufuhr von
- Blei zu Blutarmut, Schlaflosigkeit, Reizbarkeit.
- Cadmium zu erhöhtem Knochenabbau oder erhöhter Infektanfälligkeit.
- Quecksilber zum Kribbeln der Haut sowie Störungen der Bewegungskoordination oder Einengung des Gesichtsfeldes.
Teil 4: Sekundäre Pflanzeninhaltstoffe
|