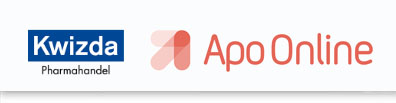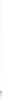Antikanzerogen (Vorbeugung von Krebserkrankungen): Anthocyane, Carotinoide, Flavonoide, Glucosinolate, Monoterpene, Phenolsäuren, Phytinsäure, Phytoöstrogene, Phytosterine, Proteaseinhibitoren, Saponine, Sulfide
- Antimikrobiell (Schutz vor Bakterien, Viren und Pilzen): Flavonoide, Glucosinolate, Phenolsäuren, Saponine, Sulfide
- Antioxidativ (Hemmung der Bildung freier Radikale und anderer schädigender Verbindungen): Anthocyane, Carotinoide, Flavonoide, Glucosinolate, Phenolsäuren, Phytinsäure, Phytoöstrogene, Proteaseinhibitoren, Sulfide
- Antithrombotisch (Vorbeugung von Blutgerinnseln): Anthocyane, Glucosinolate, Sulfide
- Immunmodulierend (Stärkung des Immunsystems): Carotinoide, Flavonoide, Glucosinolate, Phytinsäure, Saponine, Sulfide
- Entzündungshemmend: Anthocyane, Proteaseinhibitoren, Saponine, Sulfide
- Blutdruck regulierend: Sulfide
- Cholesterin senkend: Glucosinolate, Phytinsäure, Phytosterine, Saponine, Sulfide
- Blutglucose stabilisierend: Phytinsäure.
Ausgewählte sekundäre Pflanzenstoffe im Detail
Anthocyane
Anthocyane sind eine Untergruppe der Flavonoide (s.u.).
Vorkommen: in roten, blauen und violetten Obst- und Gemüsesorten sowie in deren Säften und in Weinen. Rote und schwarze Hülsenfrüchte.
Wirkung: antikanzerogen, antioxidativ, antithrombotisch und entzündungshemmend
Carotinoide
Carotinoide findet man in gelb-rot-orangem und grünblättrigem Obst und Gemüse. Es existieren über 600 verschiedene Verbindungen, in etwa 50 davon sind Vitamin A-Vorstufen. Wichtige Vertreter sind: alpha- und beta-Carotin, Lycopin, Lutein, Zeaxanthin.
Vorkommen: Karotten, Kürbis, Tomaten, Wirsingkohl, Brokkoli, Blattsalat, Spinat, Marillen und Kiwis
Wirkung: antikanzerogen und antioxidativ.
Besonderheiten: Carotinoide aus roten und gelben Obst- und Gemüsesorten sind leichter vom Körper zu verwerten, wenn sie kurz erhitzt, zerkleinert und mit ein paar Tropfen Öl genossen werden. Dadurch kann der Körper die fettlöslichen Vorstufen von Vitamin A besser aufnehmen. Carotinoide aus den grünen Obst- und Gemüsesorten sind sehr hitzeempfindlich.
Flavonoide
Flavonoide sind Farbstoffe in Obst und Gemüse.
Vorkommen: in der Schale von gelben, roten und violetten Obst- und Gemüsesorten (Äpfel, Beeren, Kartoffeln, Trauben, Rotkraut, Weichseln und Zwiebeln).
Wirkung: antikanzerogen, antimikrobiell, antioxidativ, antithrombotisch, immunmoduliernd
Besonderheiten: Polyphenole befinden sich großteils in oder direkt unterhalb der Schale beziehungsweise in der Randschicht des Getreides.
Glucosinolate
Glucosinolate, auch Senföle genannt, sind für den scharfen Geschmack diverser Gemüse- und Gewürzsorten verantwortlich.
Vorkommen: Wirsing, Kraut, Brokkoli, Karfiol, Kren, Kresse, Rettich oder Senf.
Wirkung: antikanzerogen (v. a. hormonabhängige Tumorarten), antimikrobiell, antioxidativ, immunmoduliernd
Besonderheiten: Die gesundheitsfördernde Wirkung wird erst durch Zerkleinerung (schneiden, kauen) und Sauerstoffkontakt aktiviert. Glucosinolate sind sehr hitzeempfindlich und laugen beim Garen im Wasser aus. Durch fermentative Prozesse wie z. B. Milchsäuregärung (Sauerkrautherstellung) können Glucosinolate abgebaut werden.
Phenolsäuren
Phenolsäuren werden auch als Gerbstoffe bezeichnet und sind für den herben Geschmack in Trauben, Walnüssen und schwarzem Tee verantwortlich.
Vorkommen: Vollkorngetreide, Vollkorn, Nüsse, Tee, Kaffee, in roten Trauben (auch Traubensaft und Rotwein).
Wirkung: antikanzerogen, antimikrobiell, antioxidativ
Besonderheiten: Phenolsäuren befinden sich großteils in oder direkt unterhalb der Schale beziehungsweise in der Randschicht des Getreides.
Phytoöstrogene
Phytoöstrogene sind dem menschlichen Sexualhormon Östrogen im Aufbau und in der Wirkung sehr ähnlich. Sie dienen der Pflanze als Gerüstsubstanz und stabilisieren die Randschichten von Samen und Getreidekörnern. Phytoöstrogene werden in die Untergruppen der Isoflavonoide und Lignane eingeteilt.
Vorkommen: Isoflavone sind hauptsächlich in Sojabohnen und Rotklee enthalten, Lignane hingegen in den Randschichten von Getreide sowie in Leinsamen, Pflanzenölen und Kohlgemüse.
Wirkung: antikanzerogen und antioxidativ
Die Bedeutung von Isoflavonen für die Prävention klimakterischer Beschwerden wird kontrovers diskutiert und derzeit als nicht überzeugend eingestuft.
Besonderheiten: Phytoöstrogene sind hitzestabil.
Phytosterine
Die Phytosterine dienen der Pflanze vorwiegend als Botenstoffe. Sie werden vom Körper nur in sehr kleinen Mengen aufgenommen und entfalten ihre Wirkung im Darm. Sie sind die natürlichen Gegenspieler des tierischen Cholesterins.
Vorkommen: in allen fettreichen Pflanzenteilen (Samen, Nüsse, Kerne sowie in den daraus hergestellten nativen Ölen) und in Sojabohnen.
Wirkung: Phytosterine senken den Cholesterinspiegel im Blut und sind antikanzerogen (v.a. gegen Dickdarmkrebs).
Besonderheiten: Bei der Ölraffination gehen diese wertvollen Substanzen verloren.
Protease-Inhibitoren
Protease-Inhibitoren verhindern in den Pflanzensamen einen vorzeitigen Abbau von Speicherproteinen.
Vorkommen: in eiweißreichen Pflanzen, wie Getreide, Hülsenfrüchten und Kartoffeln
Wirkung: antioxidativ und antikanzerogen
Besonderheiten: Protease-Inhibitoren sind hitzeempfindlich. Sie können auch vom Körper selbst gebildet werden.
Saponine
Saponine neigen in wässrigen Lösungen zu starker Schaumbildung (Sapon = Seife). Zudem weisen sie einen bitteren Geschmack auf.
Vorkommen: in Hülsenfrüchten (Kichererbsen, Sojabohnen), Lakritze, Spinat, Spargel und Hafer
Wirkung: antikanzerogen, antimikrobiell, immunmodulierend, entzündungshemmend, Cholesterin senkend
Besonderheiten: Saponine sind hitzestabil und wasserlöslich. Beim Kochen werden sie daher leicht ins Kochwasser ausgeschwemmt.
Sulfide
Sulfide sind schwefelhaltige Verbindungen. Sie sind für das scharfe Aroma von Lauchgemüse verantwortlich. Die Substanzen werden erst beim Zerkleinern freigesetzt.
Vorkommen: Zwiebel, Porree (Lauch) und Knoblauch.
Wirkung: antikanzerogen, antimikrobiell, antioxidativ, antithrombotisch, immunmodulierend, entzündungshemmend, Blutdruck regulierend, Cholesterin senkend
Besonderheiten: Sulfide verflüchtigen sich schnell an der Luft.
(Mono)Terpene
Sie sind für das typisches Aroma vieler Pflanzen verantwortlich. Bekannte Beispiele sind Menthol in der Pfefferminze und Limonen im Zitrusöl.
Vorkommen: Terpene sind in diversen Obstsorten sowie in Kräutern und Gewürzen enthalten.
Wirkung: antikanzerogen.
Besonderheiten: Diese sekundären Pflanzenstoffe verflüchtigen sich sehr schnell.
Empfehlungen über die Zufuhr einzelner sekundärer Pflanzenstoffe können anhand der bisherigen Datenlage nicht gegeben werden. Mit einer gemischten Kost nehmen wir täglich ca. 1,5g sekundäre Pflanzenstoffe auf. Bei Vegetariern liegt die Aufnahmemenge deutlich höher. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt einen hohen Verzehr von Obst und Gemüse sowie weitere pflanzlicher Lebensmittel, um eine gute Versorgung mit sekundären Pflanzenstoffen sicherzustellen.
B) Ausgewählte gesundheitsschädliche sekundäre Pflanzenstoffe
Die für den Menschen bzw. tierischen Organismus gesundheitsschädlichen (toxischen) sekundären Pflanzenstoffe dienen der Pflanze in erster Linie zum Schutz vor Tierfraß.
Mit Hilfe unseres Geruchs- und Geschmackssinns können wir diese Substanzen erkennen (z.B. durch einen bitteren Geschmack) und meiden. Zudem gibt es körpereigene Systeme (Entgiftungsenzyme), welche uns schützen. Auch bestimmte Verarbeitungsverfahren, beispielsweise das Erhitzen von Lebensmitteln hilft, den Gehalt an toxischen Substanzen in Nahrungsmitteln zu senken bzw. zu eliminieren.
Ätherische Öle
Die Muskatnuss enthält Myristicin und Elemicin, welche bei einem übermäßigen Verzehr zu optischen Halluzinationen, Steigerung der Herzfrequenz und Blutdruckschwankungen führen können.
Blausäure
Blausäure (Cyanwasserstoff) ist ein starkes Gift. Der Toleranzbereich liegt, individuell unterschiedlich, zwischen 1 und 60 mg/kg Körpergewicht. Das heißt es kann auch schon eine Dosis von 1 mg/kg Körpergewicht beim Menschen tödlich wirken.
Blausäure hemmt ein wichtiges Enzym der Atmungskette und verhindert dadurch den Sauerstofftransport im Körper. Es kommt in weiterer Folge zu einem raschen Absterben der Gehirnzellen aufgrund des entstandenen Sauerstoffmangels.
Vorkommen: Es gibt über 1000 Pflanzen, die diese Substanz produzieren, zu den bekanntesten zählt die Bittermandel mit einem Gehalt von ca. 2,5g/kg. Weitere blausäurehaltige Pflanzen sind z.B. die unreife Bambussprosse (bis 8g/kg), Leinsamen, Fruchtkerne aus Zitrusfrüchten sowie Steinobst (Äpfel) und die bei uns heimische Gartenbohne.
Besonderheiten: Durch Erhitzungsvorgänge wie z.B. Kochen kann die toxische Wirkung der Blausäure aufgehoben werden. Vorsicht bei Bittermandeln und Bittermandelöl. Schon die Aufnahme von 5-10 Stück bzw. 10 Tropfen Bittermandelöl kann vor allem bei Kindern tödlich sein.
Oxalsäure
Oxalsäure kann mit Calcium eine Bindung eingehen und den wasserunlöslichen Komplex Calciumoxalat bilden. Die Aufnahme des Calcium wird somit verhindert.
Vorkommen: Spinat, Sellerie, Rote Rüben und Rhabarber.
Besonderheiten: Personen, die zur Ablagerung von Nierensteinen auf Basis von Calciumoxalat neigen, sollten oxalsäurereiche Lebensmittel meiden.
Solanin
Solanin wird in Nachtschattengewächsen wie Kartoffeln und Tomaten gebildet. Enthalten ist es in den grün gefärbten Pflanzenteilen.
Vergiftungen können ab einer Konzentration von 1 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht auftreten. Daher sind insbesondere Kinder gefährdet. Die akuten Vergiftungssymptome sind: Brennen und Kratzen im Hals, Magenbeschwerden, Darmentzündungen, Gliederschmerzen, Übelkeit, Brechreiz, Nierenreizungen, Durchfall. In schlimmen Fällen kann es zur Auflösung der roten Blutkörperchen, Störungen der Kreislauf- und Atemtätigkeit sowie Schädigungen des zentralen Nervensystems (Krämpfe, Lähmungen) kommen.
Besonderheiten: Schälen und/oder großzügiges Wegschneiden der grünen Stellen vermindert den Solaningehalt deutlich. Solanin tritt beim Kochen weitgehend in das Kochwasser über, weshalb auf die Weiterverwendung der Garflüssigkeit verzichtet werden soll.
Beim Einkauf stets die Qualität der Kartoffeln, Tomaten überprüfen. Bei der Lagerung von Kartoffeln ist Lichteinwirkung zu vermeiden, da dies die Bildung von Solanin fördert.